Ilona Hartmann ist freie Redakteurin für Mit Vergnügen, Berlinfrischling, schlecht mit Alkohol, Hobbyphilosophin auf Schülersprecherniveau und eine fantastische Redakteurin und Autorin. Für unsere Rubrik Reader’s Note hat uns Ilona lange mit diesem Text warten lassen, doch Geduld ist eine Tugend und die Frier- und Frostgeschichten aus dem Leben einer Jackenverweigerin hat unseren Tag erhellt und wir sind uns sicher, dass er euch mindestens genauso glücklich machen wird.
Anfang November war es mal kurz ein bisschen kalt. Vielleicht war ich zu diesem Zeitpunkt ohnehin etwas dünnhäutig, vielleicht lag es aber auch an akuter Mittezwanzigjährigkeit und dem damit einhergehenden Gefühl, ich müsse nun endlich mal vernünftige Kaufentscheidungen treffen. Jedenfalls kaufte ich eine sehr dicke schwarze Winterjacke. Wo die Mode sonst unermüdlich Trends gebiert, die uns gleichzeitig in die Privatinsolvenz und den Erfrierungstod treiben, machte sie diese Saison eine gnädige Ausnahme und bescherte uns mit Puffer Jackets ein Kleidungsstück, das zumindest die Sache mit der tödlichen Unterkühlung recht unwahrscheinlich macht. Denn diese Art von Jacke ist im Grunde nichts als viele zusammengenähte Sofakissen und verspricht als solche Komfort, Wärme, Gemütlichkeit und eine leichte Airbagfunktion im Falle eines Glatteisunfalls. Eine Art modegewordene Überlebenseinladung für den Winter. Ich nahm dankend an.
Und mehr noch: Puffer Jackets sind das späte Zugeständnis an unsere Mütter nach Jahren der pubertären Streitereien im Klamottenladen oder im Hausflur. All die Jahre des erbitterten Kampfes – als Kind wollte ich nämlich partout und niemals eine Jacke tragen, schon gar keine warme. Sobald ich außer Sichtweite war, riss ich mir ungeachtet der Außentemperaturen alles wieder vom Leib, was man mir kurz zuvor mühevoll mit Reiß-, Klett-, und Knopfverschlüssen am Körper arretiert hatte. Krank war ich nie, mein triumphaler Stolz härtete mich ab. Meine Mutter seufzte neulich dennoch erlöst „Endlich trägst du mal eine anständige Winterjacke!“ als sie meines Anblicks im schwarzgesteppten Daunentraum gewahr wurde. Und zu meiner eigenen Überraschung führte dieses Lob nicht zum sofortigen Wertverfall meines Vernunftkaufs. Im Gegenteil: Ich fühlte mich zufrieden und wohl – und schwitzte ein bisschen. Revolutionär: Schwitzen im Winter! Um an diesen Punkt zu kommen, hat es nur 20 Jahre Winterjackenkarriere gebraucht.
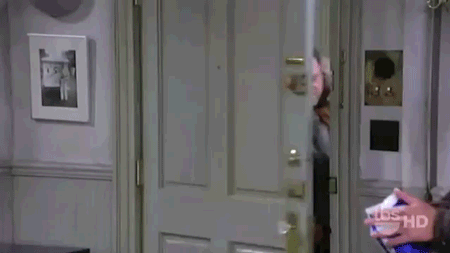
Denn wie ich so meine bestandene Reifeprüfung in Sachen saisonal angemessener Kleidung genoss, erinnerte ich mich an meine Grundschulzeit, als gerade Ende der 90er die erste Generation gesteppte Daunenjacken en vogue waren, sogar in der Kleinstadt, in der ich aufwuchs. Die älteren Kids aus der benachbarten Realschule hatten alle so eine an, während sie heimlich vor dem Eingang des Schulgeländes rauchten. Die Mädchen trugen dazu camelfarbene Buffalos und hellblaue Miss Sixty-Jeans mit Reißverschluss hinten. Zwischen Hosenbund und Jackenbund mussten mindestens acht Zentimeter nackte, leicht gebräunte Haut zu sehen sein und wer es geschafft hatte, die Unterschrift der Mutter gut zu fälschen, hatte sogar schon ein Tribal im Steiß. Jungs kombinierten zu ihrem Daunenbomber tief im Schritt hängende Baggyjeans, Basecaps und betont lässig nicht zugeschnürte Timberlands oder das, was im örtlichen Einzelhandel als solche verkauft wurde. Ich selbst, zum damaligen Zeitpunkt ungefähr zehn Jahre alt, trug einen zu großen, dick gefütterten, taubengrauen Anorak mit silbernen Reflektorstreifen und sah darin aus wie ein verkehrssicherer, kleiner Blauwal. Natürlich zog ich das Ding noch auf dem täglichen Weg zum Schulbus aus und klemmte sie zwischen Rücken und Rucksack. Erst nachdem ich schließlich in einem sehr schneereichen Winter einige triumphale Siege aus Schneeballschlachten trockenen Fußes darin nach Hause getragen hatte, versöhnte ich mich langsam mit diesem Ungetüm. Es blieb zwar eine hässliche, kratzige, einengende Jacke, aber die harten Schneebälle voller Eisklumpen und Rollsplit, mit denen uns die Jungs aus dem Nachbardorf befeuerten, konnten mir darin nichts mehr anhaben. Aufgrund eines unvermittelten Wachstumsschubes hatte ich leider nicht mehr besonders lange etwas davon, denn die Ärmel reichten mir bald nicht einmal mehr bis zu den Handgelenken und die Gummibündchen schnitten schmerzhaft in die Haut ein. Meine Mutter und ich brachten die Jacke zur Kleiderspende und ich fühlte mich dabei wie ein Ritter, der sein treues Schlachtross zum Abdecker bringt. Es war ein widerwilliger Abschied von der letzten Jacke meiner Kindheit.

Im Winter darauf, ich war nun erwachsen und ging seit Kurzem aufs Gymnasium, folgte eine grausilberne Winterjacke mit Teddyfutter, die ich aus Gründen der Entscheidungsverweigerung und Scheißegalheit von Mode einfach von meiner Oma übernahm. Sie war weder besonders schön noch besonders funktional und auch wieder irgendwie nicht richtig passend, aber die Zeiten von stundenlangen Schneeballschlachten waren vorbei, und ich ohnehin viel zu sehr mit Hausaufgaben abschreiben und Jungs ignorieren beschäftigt. Die Winter zogen ins Land und das einzige, was sich im Bezug auf diese Jacke änderte, war die Frage, ob man unter ihr schon Brüste erkennen konnte. Von „Hoffentlich nicht!“ bis „Na, hoffentlich!“ dauerte es etwa drei Jahre und ab diesem Zeitpunkt war auch mein modisches Interesse wieder in meinen sich nun irritierenderweise weniger erwachsen als je zuvor anfühlenden Körper zurückgekehrt. Weil mir der silberne Großmutterjanker sofort peinlich war, entsorgte ich ihn eigenhändig an einem der ersten wärmeren Frühlingstage auf dem Nachhauseweg von der Schule in einem Kleidercontainer und war: frei. Das war 2004 und damit das Jahr, als Avril Lavigne von einem „Happy Ending“ sang, das allerdings noch lange nicht in Sicht war, wenn man sich wie ich auf dem Höhepunkt der Pubertät befand.

Was ab Mitte Oktober desselben Jahres begann, war eine persönliche Eiszeit, denn diesen Winter und alle darauffolgenden verbrachte ich schlotternd in androgynen Wollmänteln mit dünnem Synthetikfutter. Die waren herrlich unvernünftig und ich fand mich darin wunderbar intellektuell leidend. Meinen Erziehungsberechtigten blieben regelmäßig die Augenbrauen kurz unter dem Haaransatz stehen, wenn sie mich so ins Schneetreiben hinausschweben sahen. Sollten ruhig diese Mädchen aus der Parallelklasse, die im Winterurlaub mit ihren nicht geschiedenen Eltern nach Südtirol in den Skiurlaub fuhren, ihre warmen Pelzkragenjäckchen anziehen. Ich hingegen blieb zu Hause, las Flaubert und fror, genauso wie Flaubert 1870 in Paris gefroren haben musste. Wir waren vereint im Schmerz unserer absterbenden Füße. Dass Flaubert nie in Paris gelebt und damit auch dort nie gefroren hatte, fand ich erst später heraus und empfand diesen Irrtum als großen nachträglichen Betrug. Die Winter zwischen 2005 und 2015 verharrte ich also mit hochgezogenen Schultern, die Händen tief in den Taschen vergraben und mit verkniffenem oder vielleicht einfach festgefrorenem Gesicht. So nobel, wie ich mich damals mit meinem modischen Komfortverzicht gefühlt hatte, sah ich rückblickend wahrscheinlich nicht aus.
Nun also: Frieden mit den Winterjacken. Oder: eine Art Vorstufe davon. Denn eines ist klar: So anmutig wie in den elegant geschnittenen Wollmänteln finde ich mich in diesem vernünftigen Daunenmonster natürlich nicht, ganz im Gegenteil. An miesen Tagen würde ich mir gerne ein Schild um den Hals hängen, auf dem steht „Unter dieser ausladenden Jacke steckt ein menschlicher Körper, kein Ölfass!“ Wenn ich mich damit behäbig zwischen engen Supermarktgängen bewege und mit einer ungeschickten Bewegung eine Ladung
Soßenbinder aus dem Regal wische, bilde ich mir ein, dieses warnende Piepen wie bei einem 12-Tonner im Rückwärtsgang zu hören. Wie hatte ich mich jemals so flink und schnell bewegen können wie damals, wenn ich mich vor fliegenden Eisklumpen wegduckte? Womöglich muss ich noch eine Weile darin reifen respektive schwitzen, ehe aus mir der nötige Funken Eitelkeit gewichen ist. Und kann dann zurückkehren zu jenem kindlichen Funktionalismus, der mich Kleidung nicht in erster Linie für ihre äußere Form wertschätzen lässt, sondern für das, wozu sie mich befähigt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder eine anständige Schneeballschlacht machen. Gut gepolstert für gegnerische Schneebälle wäre ich ja.

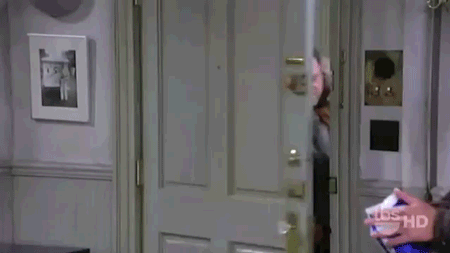






6 Antworten zu “Reader’s Note: Frier- und Frostgeschichten aus dem Leben einer Jackenverweigerin”
herrlich! ich habe sehr gelacht <3
Dieser Beitrag ist ja ein Traum! :) Ich konnte mich in mehreren Phasen wieder finden und musste laut lachen! Wirklich genial zusammen gefasst!
Liebst, Jacqueline http://www.jacquelineisabelle.com
Großartigst <3
[…] meine Daunendecke in Jackenform, die ich die letzten Wochen tagein, tagaus trug. Zum ersten Mal war mir nicht kalt, und das, obwohl es ja mal nun wirklich kalt war, diesen Januar. Der Puffcoat gab mir täglich das […]
[…] wird eisig und die Knöchel zittrig. Nichts wünscht man sich plötzlich mehr als einen Schal und seine Daunenjacke, eine Tasse dampfenden Tee oder noch besser eine heiße Badewanne. Doch wie immer war es auch an […]
[…] Ilona ist nicht nur auf Twitter einer der schlauesten und lustigsten Menschen, die ich kenne. Egal, was ich von ihr lese, ich will mehr davon – und das ist jetzt in einem ganzen Roman möglich. Land in Sicht ist, […]